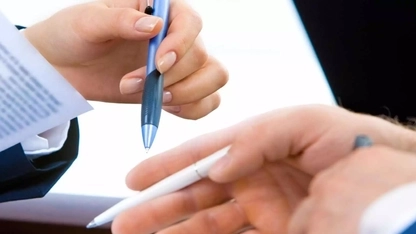Behindertengerechter Arbeitsplatz
Barrierefreiheit im Arbeitsumfeld
Ob ein Arbeitsplatz behindertengerecht ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, denn jeder Mensch mit Behinderung hat andere Bedürfnisse, um problemlos arbeiten zu können. In manchen Fällen können spezielle Hilfsmittel oder Anpassungen einen Arbeitsplatz für eine*n Mitarbeiter*in mit Behinderung nutzbar machen. Oftmals ist es aber auch die nicht vorhandene Barrierefreiheit des Gebäudes, welches für Arbeitnehmer*innen mit Behinderung eine Barriere darstellt. Wir zeigen Ihnen die Bereiche die grundsätzliche Barrierefreiheit eines Unternehmens- oder Bürogebäudes verbessern.
Barrierefreier Außenbereich
In der Nähe des Gebäudeeingangs sollten Pkw-Stellplätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stehen. Für das Ein- und Ausladen eines Rollstuhls muss genug Platz zur Verfügung stehen. Gefälle im Gelände stellen eine Herausforderung für Personen mit Gehbehinderung dar.
Bodenbeläge
Bodenbeläge sollten rutschfest, antistatisch und fest verlegt sein. Damit Rollstuhlfahrer*innen gut rangieren können, braucht es in allen Räumen freie Flächen und hinter den Schreibtischen einen Wenderadius von mindestens anderthalb Metern.
Rampen
Rampen helfen Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen kleine Schwellen zu überwinden und sind eine Alternative zu Stufen auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Sie müssen ausreichend breit sein und mit Handläufen sowie Randabweisern ausgestattet sein.
Flure
Breite Fluren (mindestens 1,80 Meter) lassen genug Platz, damit zwei Rollstühle aneinander vorbeifahren können.
Fahrstühle
Aufzüge (oder alternativ Hebeplattformen) sind für Rollstuhlfahrer*innen und Menschen mit Gehbehinderung wichtig, um Höhenunterschiede zu überwinden. Sie müssen ausreichend groß sein - nämlich 1,10 Meter breit und 1,40 Meter lang. Die Türen sollten 90 Zentimeter breit sein.
Sanitärbereiche
Barrierefreie und rollstuhlgerechte Sanitärbereiche und Sozialräume müssen anhängig von der Mitarbeiter*innen-Zahl in ausreichender Anzahl vorhanden sein.
Barrierefreie Arbeitsplatzausstattung und Technik
Moderne Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten sowie eine barrierefreie Arbeitsplatzausstattung sind eine große Erleichterung für viele Menschen mit Behinderung. Wenn Firmen darauf achten, ermöglichen sie ihren Mitarbeiter*innen Teilhabe am Berufsleben und selbstständiges Arbeiten. Für die Arbeit am Computer gibt es beispielsweise viele Hilfsmittel wie:
- spezielle Eingabegeräte: Sondertastaturen, Mausersatzgeräte oder Spezialmäuse, Joysticks, Augensteuerung oder Spracherkenner.
- Software: Sie bietet zum Beispiel direkte Spracheingabe, eine Bildschirmvergrößerung oder simuliert die Funktion von Maustasten.
Auch Kommunikationshilfen spielen im Arbeitsalltag eine große Rolle. Je nach motorischen Fähigkeiten oder Art der Behinderungen können Mitarbeiter*innen auf Kommunikationsgeräte mit Schrift, Braillezeichen und Symbolen oder Sprachcomputer zurückgreifen. Besonders wichtig ist natürlich auch im Berufsalltag das Internet für Informations- und Kommunikationszwecke. Durch barrierefreie Websites können es die meisten Menschen nutzen.
Finanzielle Unterstützung und Förderung für den Umbau von Arbeitsplätzen
Für Firmen, die die Arbeitsumgebung ihrer Mitarbeiter*innen barrierefrei gestalten wollen, gibt es viele verschiedene Fördermöglichkeiten. Gefördert werden alle Arbeitsmittel, die für die behinderungsgerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes notwendig sind (zum Beispiel Computersysteme für blinde und sehbehinderte Menschen, spezielle Bürostühle, Hebewerkzeuge). Darüber hinaus werden auch Kosten für die Gestaltung des barrierefreien Zugangs zur Arbeitsumgebung gefördert (zum Beispiel Einbau einer Behindertentoilette, Bau von Rampen für Rollstühle). Die Förderung trägt bis zu 100 Prozent der Kosten. Das bezieht sich beispielsweise auf die Anschaffung, Wartung und Instandhaltung von Einrichtung, Technik und Hilfsmitteln. Doch auch Schulungen, in denen Mitarbeiter*innen lernen, verschiedene Hilfsmittel zu nutzen, werden bezahlt.
Sind die technischen Arbeitshilfen stark personenbezogen (zum Beispiel Sehhilfen, Braillezeilen, Sicherheitsschuhe, auch spezielle Bürotische oder Bürostühle), beantragt der oder die Beschäftigte das Hilfsmittel selbst. Falls die Arbeitsmittel nur von einzelnen Beschäftigten gebraucht werden, kümmern diese sich selbst um den Antrag für Hilfsmittel. Wechseln sie den Arbeitsplatz, können sie diese behalten.
Dafür zuständig ist je nach individueller Situation (Wann und durch was ist die Behinderung entstanden?) das Integrationsamt/Inklusionsamt oder ein Rehabilitationsträger (vor allem Agentur für Arbeit, gesetzliche Unfallversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung). Als erste Anlaufstelle bietet sich allerdings das Integrationsamt/Inklusionsamt an.
Informationen, welche Fördermittel Ihnen als Arbeitgeber zustehen, erhalten Sie auch bei der für Sie zuständigen Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber , die alle Informationen und Möglichkeiten bündelt.
Beratungsangebote zur Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze
Die Integrationsämter fördern die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Dafür steht ihnen einen Teil aus dem Budget der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.
Bei den jeweiligen Integrationsämtern können Sie kostenlos einen technischen Beratungsdienst in Anspruch nehmen. Diese beraten dazu, wie man Arbeitsplätze behindertengerecht ausstattet. Darüber hinaus sind dort die Integrationsfachdienste ansässig.
Rehadat ist ein Informationsportal zur beruflichen Teilhabe. Zu Rehadat gehören verschiedene Informationsportale rund um das Thema Inklusion.
Auf dem Portal talentplus informiert Rehadat Arbeitgeber unter anderem zum Thema BEM . Außerdem finden Sie dort, welche Hilfen im Arbeitsleben gefördert werden. Außerdem finden Sie dort einen Link zu einer Förderfinder App .
Die deutsche Rentenversicherung ist ein Rehabilitationsträger und zuständig bei Rehabilitationsfällen, die nach 15 Jahren Berufsleben passieren.
Die deutsche Rentenversicherung informiert Arbeitgeber*innen über das Betriebliche Eingliederungsmanagement. Es gibt auch ein kostenloses Servicetelefon, das Unternehmen berät: 0800 1000 4800
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) e. V. ist ein Zusammenschluss zur Förderung und Koordinierung der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.
Insbesondere für rechtliche Hintergründe und vertiefende Informationen empfehlenswert.
Das Informationsportal des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales „einfach teilhaben “ stellt Informationen rund um das Thema Inklusion zur Verfügung.
Sie finden hier auch Informationen zur stufenweisen beruflichen Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell, zum betrieblichen Eingliederungsmanagement und zu Arbeitsassistenz. Die entsprechenden Gesetzestexte sind verlinkt und es gibt die Möglichkeit per Bürgertelefon Informationen zu erhalten.
Darüber hinaus informiert es auch zum Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement.
Wenn Sie wissen möchten, welche Hilfsmittel gesundheitliche Einschränkungen kompensieren können, haben Sie die Möglichkeit sich bei der technischen Jugend- freizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH (tjfbg) zu informieren.
Die tjfbg vermittelt ausführliche Informationen über behinderungskompensierende Techniken und Technologien für Computer und Internet.
Der technische Beratungsdienst der Agentur für Arbeit hilft Ihrem Unternehmen, die passenden Arbeitsmittel und Hilfen auszuwählen. Die Berater*innen zeigen Ihnen, wie ein Arbeitsplatz an die Bedürfnisse behinderter Menschen angepasst werden kann. Die Beratungsstelle ist kostenlos telefonisch erreichbar unter: Tel.: 0800 4 555520.
Viele verschiedene Träger beraten Unternehmen zum Thema Inklusion. Von den Rentenversicherungsträgern über die Agentur für Arbeit oder die Integrationsämter - es gibt verschiedene Ansprechpartner*innen. Für Unternehmen, die nicht täglich mit diesen Förderwegen zu tun haben, gestaltet sich dieser Prozess unübersichtlich. Die Einheitlichen Ansprechstellen machen es Unternehmen leichter, Menschen mit Behinderung einzustellen.
Mehr Informationen zu den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber.