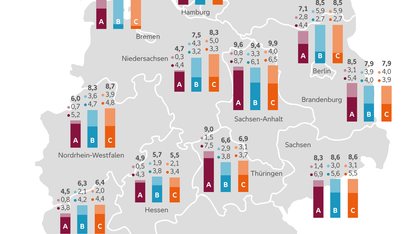Herausforderungen inklusiver Bildung

Ist von Bildung die Rede, assoziiert man damit oftmals nur die Institution Schule. Junge Menschen bilden sich aber keineswegs nur in diesem formellen Lernsetting, sondern auch außerhalb davon: im Sportverein, Jugendzentrum, Kindergarten, bei der Nachmittagsbetreuung, der Nachhilfe oder im Rahmen persönlicher Freizeitaktivitäten.
Die Herausforderungen im Überblick
Strukturen
Vernetzung & Zusammenarbeit
Unterstützung
Partizipation
Begegnung
Digitale Teilhabe
Impulse für die Praxis
Wie lässt sich das Recht auf inklusive Bildung umsetzen?
Zusammen können schulische und außerschulische Akteur*innen die Herausforderungen inklusiver Bildung am besten meistern. Dafür braucht es das Bewusstsein für die Potentiale einer gemeinsamen Umsetzung von Inklusion, ein gemeinsames Leitbild, durchdachte Umsetzungskonzepte und sozialraumorientiertes Handeln:
-
Bewusstsein schaffen
Bildungsakteur*innen beider Seiten muss klar werden, welche wichtige Rolle inklusive Bildung bei der die Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung junger Menschen spielt, sie müssen von den Mehrwerten überzeugt sein und ihre Arbeit daran ausrichten.
-
Gemeinsames Leitbild & Werte
Schulische und außerschulische Partner*innen sollten zusammen eine "Vision" entwickeln, in deren Rahmen sie sich den für sie wichtigsten Werten verpflichten. Idealerweise verankern sie daneben eine gemeinsame, von allen getragene Zielsetzung, die sie auch öffentlich vertreten.
-
Umsetzungskonzepte entwickeln
Für gemeinsames (ganztägiges) Lernen und vielfältige Bildungsgelegenheiten braucht es durchdachte Konzepte und Strukturen, die auch über Institutionen hinaus effektives Arbeiten ermöglichen. Es gibt bereits viele gute inklusive Beispiele und Konzepte, deren Erfahrungswerte durch Hospitation und Austausch in die Breite getragen werden können.
-
Bildung als Lebensraum
Die pädagogische Arbeit sollte sich eng an den konkreten Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen orientieren. So können alltägliche Aufenthaltsorte der jungen Menschen als Lernorte gestaltet werden. Und auch hier spielt die Partizipation aller Beteiligten und Betroffenen eine wichtige Rolle.
Das könnte Sie auch interessieren
inklusion.de-Newsletter abonnieren
Bleiben Sie mit unserem kostenlosen Newsletter immer auf dem Laufenden – mit regelmäßigen Informationen, Tipps und Anregungen rund um das Thema Inklusion und Barrierefreiheit. Jetzt anmelden!