Mobbing erkennen, Rollen verstehen

Was ist Mobbing?
Mobbing ist nicht immer leicht zu erkennen und nicht jeder Streit ist Mobbing.
Wenn sich zum Beispiel zwei Freundinnen streiten, weil eine etwas gesagt hat, das die andere verletzt hat, dann ist das ein Konflikt. Sie sind auf Augenhöhe und können den Streit gemeinsam lösen.
Wenn jedoch ein Schüler über Wochen wiederholt ausgelacht, beleidigt und aus Gruppen ausgeschlossen wird, dann ist das Mobbing. Eine Person wird gezielt klein gemacht, während eine oder mehrere andere Personen die Kontrolle haben. Es besteht ein Machtungleichgewicht und für das Mobbing-Opfer ist es schwierig, der Situation zu entkommen.
Welche Folgen hat Mobbing?
Mobbing hat ernsthafte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das soziale Verhalten – vor allem bei den Betroffenen, aber auch bei anderen Beteiligten.
Mobbing-Opfer ziehen sich häufig zurück, verlieren das Vertrauen in sich und andere und entwickeln Ängste oder depressive Gedanken. Aber auch andere spüren Folgen: Täter*innen verlernen Mitgefühl, Mitläufer*innen fühlen sich oft schuldig, Außenstehende oder Angehörige erleben Hilflosigkeit.
Je länger Mobbing anhält, desto schwerwiegender und vielschichtiger wird die Belastung. Und auch wenn das Mobbing irgendwann endet: Die Schäden sitzen tief und die Folgen sind oft noch viele Jahre später spürbar.
Wie entsteht Mobbing?
Mobbing ist ein Gruppenphänomen und entsteht selten nur durch eine einzelne Person. Es gibt zum Beispiel jemanden, der aktiv mobbt, aber auch andere, die mitmachen, zuschauen oder mitlachen. Manche versuchen zu helfen und wieder andere halten sich komplett raus.
Wer welche Rolle einnimmt, ist nicht immer eindeutig. Eine Person, die heute gemobbt wird, kann morgen selbst andere verletzen. Es ist auch möglich, die Rolle bewusst zu wechseln, etwa indem man sich entscheidet, dem Opfer zu helfen statt wegzuschauen. Jede Person hat also die Chance, den Mobbingkreislauf zu durchbrechen.
Die Rollen beim Mobbing im Überblick
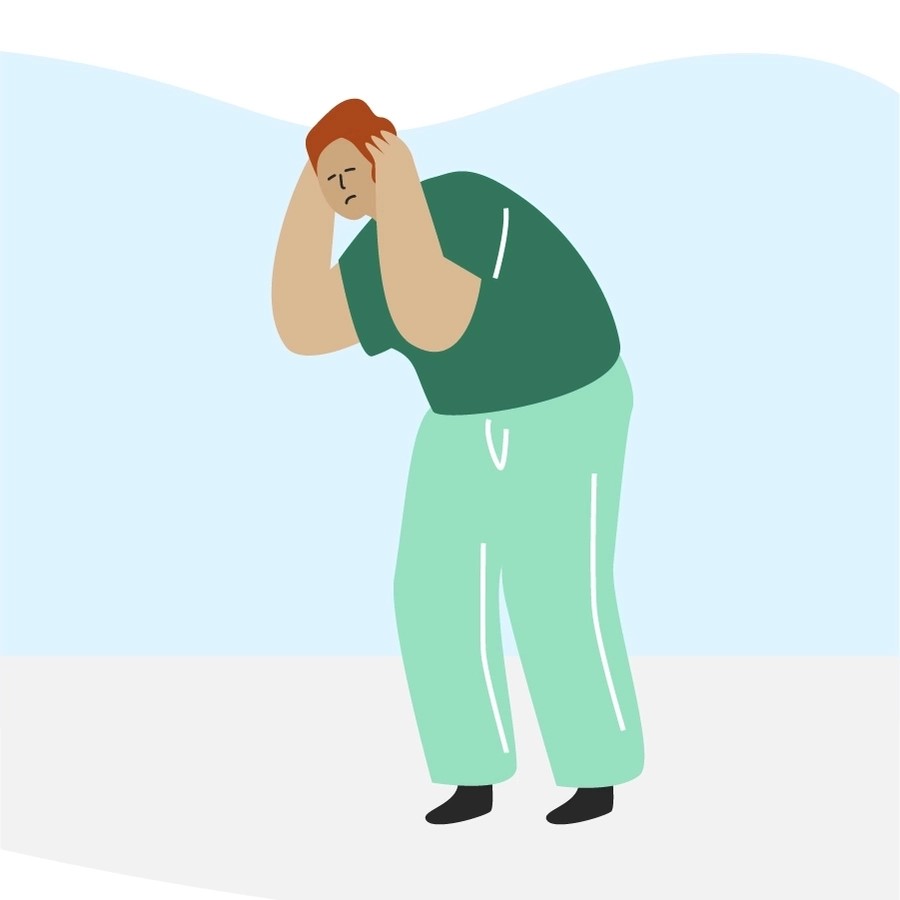
Opfer von Mobbing werden wiederholt, über längere Zeit und systematisch ausgegrenzt, beleidigt, bedroht oder schikaniert – in der Schule, im Internet oder im Alltag. Das kann sehr verletzend sein und dazu führen, dass sich die Person zurückzieht, sich schämt oder glaubt, selbst schuld zu sein. Viele sprechen nicht darüber, weil sie Angst haben, dass es dann noch schlimmer wird oder ihnen sowieso niemand glaubt.
So kannst du etwas verändern:
Du bist nicht allein – und du musst das nicht allein durchstehen. Sprich mit jemandem, dem du vertraust: Freund*innen, Lehrkräfte, Eltern oder Beratungsstellen. Auch wenn es schwerfällt – der erste Schritt kann vieles verändern. Du kannst dir Hilfe holen, dich schützen und zeigen: Ich verdiene Respekt.
Wenn du dich nicht traust, direkt zu reden, kannst du auch anders anfangen: Schreib deine Gedanken auf, such dir Infos oder chatte anonym mit einer Beratungsstelle. Jeder Schritt zählt – und du hast das Recht, dich sicher zu fühlen.

Täter*innen führen das Mobbing aktiv aus – durch Worte, Taten oder digitale Angriffe – und stacheln häufig andere an, mitzumachen. Oft steckt dahinter der Wunsch nach Anerkennung oder dem Gefühl, Kontrolle zu haben. Was dabei leicht übersehen wird: Mobbing verletzt andere tief und kann langfristige Schäden hinterlassen.
So kannst du etwas verändern:
Du hast den größten Hebel, die Situation zu verändern – und das ist eine echte Chance. Du kannst dich entscheiden, aufzuhören, dich entschuldigen und dich bewusst anders verhalten. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Reife und Stärke.
Wenn du merkst, dass du andere verletzt hast, sprich mit jemandem darüber. Du kannst lernen, Konflikte anders zu lösen und trotzdem Respekt bekommen. Veränderung ist möglich – und du kannst der Grund dafür sein, dass es jemandem wieder besser geht.
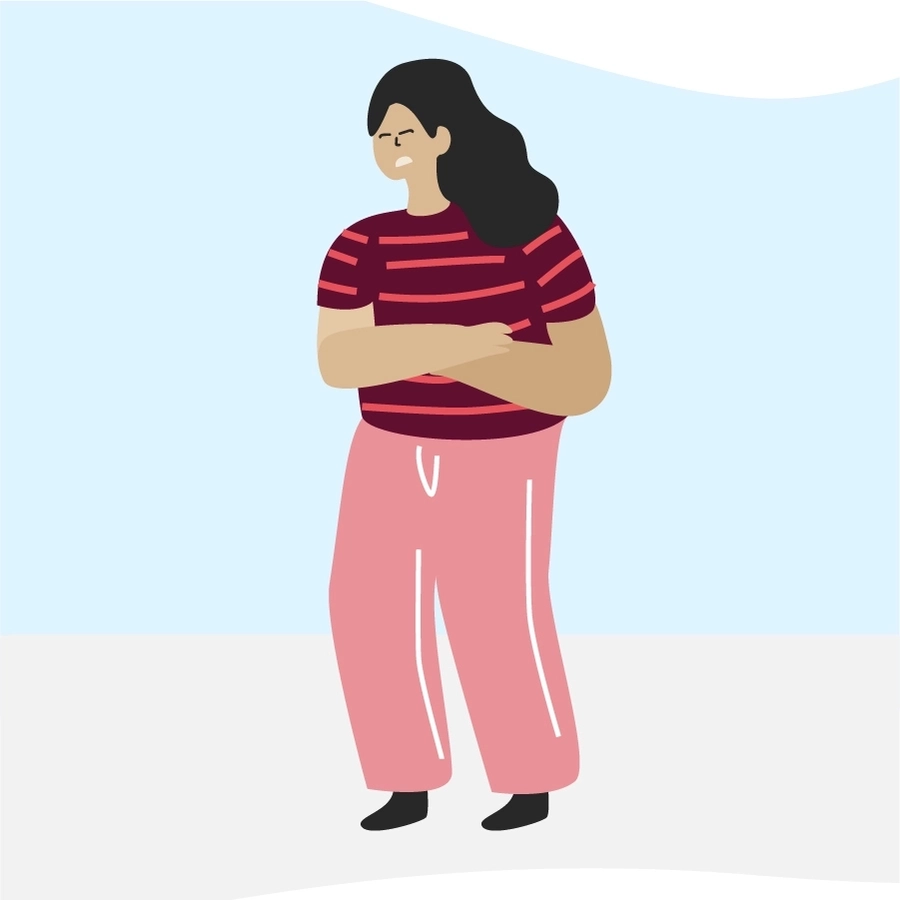
Assistent*innen unterstützen Täter*innen aktiv – zum Beispiel, indem sie Gerüchte weiterverbreiten, verletzende Inhalte posten oder bei Aktionen mitmachen. Oft passiert das, um nicht selbst zum Ziel zu werden oder um in der Gruppe dazuzugehören. Doch dieses Verhalten trägt dazu bei, dass Mobbing sich ausbreitet und für Betroffene noch belastender wird.
So kannst du etwas verändern:
Du kannst dich bewusst entscheiden, nicht mehr mitzumachen. Sag zum Beispiel „Da bin ich raus“ oder „Das geht zu weit“. Damit setzt du ein klares Zeichen – für dich und für andere. Du zeigst, dass du Verantwortung übernimmst und dich für ein faires Miteinander einsetzt.
Wenn du unsicher bist, wie du dich lösen kannst, sprich mit jemandem, dem du vertraust. Auch kleine Schritte zählen: Nicht weiterleiten, nicht kommentieren, nicht mitmachen. Du hast die Möglichkeit, den Kreislauf zu stoppen – und das ist stark.

Verstärker*innen sind nicht aktiv am Mobbing beteiligt. Sie bestätigen Täter*innen aber in ihrem Tun, zum Beispiel durch lachen, Likes oder das Teilen von Mobbing-Inhalten. Dadurch signalisieren sie Zustimmung und stabilisieren das Mobbing, weil Täter*innen sich bestätigt fühlen und Mobbing als "gesellschaftsfähig" wahrnehmen.
So kannst du etwas verändern:
Statt mitzulachen oder Inhalte zu teilen, kannst du dich entscheiden, dich auf die Seite des Opfers zu stellen. Sag zum Beispiel "Lass das, das geht zu weit" oder "Das ist nicht witzig". Durch solche Aussagen merkt die betroffene Person direkt "Ich bin nicht allein". Die Täter*innen verlieren außerdem ihr "Publikum" und werden entmutigt, weiterzumachen.
Du traust dich nicht, direkt in die Situation einzugreifen? Auch stille Signale zählen: Ein freundlicher Blick, eine unterstützende Geste oder ein späteres Gespräch mit dem Opfer können Mut machen und helfen, den Mobbingkreislauf zu durchbrechen.
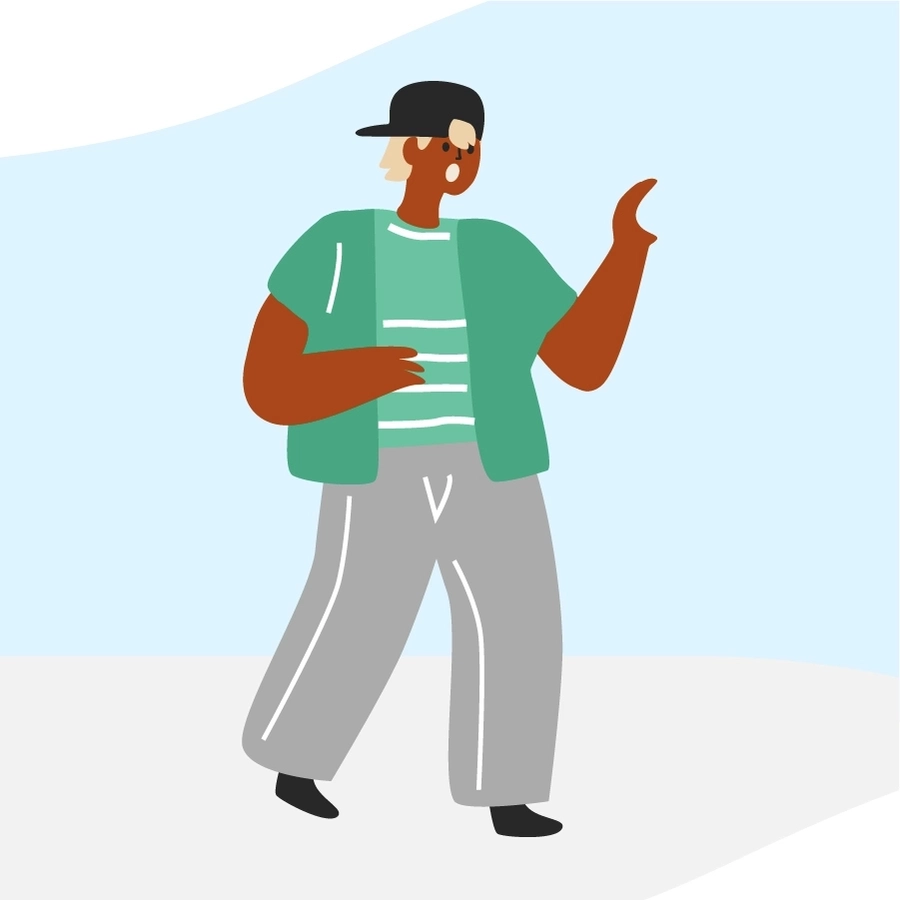
Verteidiger*innen stellen sich auf die Seite der Opfer – manchmal laut und deutlich, manchmal leise und im Hintergrund. Sie zeigen, dass Mobbing nicht okay ist und geben Betroffenen Rückhalt und das Gefühl, in der Situation nicht allein zu sein. Verteidiger*in zu sein ist oft eine besondere Herausforderung: Wer sich einmischt, riskiert selbst zur Zielscheibe zu werden oder kann sich mit der Verantwortung überfordert fühlen.
So kannst du etwas verändern:
Du kannst Betroffene direkt unterstützen – durch Worte, Gesten oder indem du sie zu einer Vertrauensperson begleitest. Auch wenn du nicht alles lösen kannst: Deine Haltung zählt und deine Unterstützung verringert den sozialen Druck auf das Opfer.
Wenn du dich unsicher fühlst, hol dir selbst Unterstützung. Sprich mit Freund*innen, Lehrkräften oder Beratungsstellen. Du musst nicht allein kämpfen – aber du kannst helfen, die Situation zum Guten zu verändern.

Außenstehende bemerken, dass etwas nicht stimmt. Das kann in der Schule sein, im Chat oder auf Social Media. Sie sind nicht direkt beteiligt, greifen aber auch nicht ein, oft aus Unsicherheit, Angst oder weil sie glauben, es sei „nicht ihr Problem“. Doch Schweigen kann Mobbing verstärken und Betroffene fühlen sich noch einsamer.
So kannst du etwas verändern:
Auch wenn du nicht direkt beteiligt bist, kannst du helfen. Sprich mit einer Vertrauensperson aus dem Umfeld des Opfers über das, was du beobachtet hast. Das können zum Beispiel Lehrkräfte, Angehörige oder Freund*innen sein. Du kannst Betroffene auch direkt ansprechen – zum Beispiel mit „Geht’s dir gut?“ oder „Ich hab gesehen, was passiert ist – du bist nicht allein.“
Wenn du dich nicht traust, direkt einzugreifen, kannst du trotzdem aktiv werden: Unterstütze das Opfer im Hintergrund, dokumentiere Vorfälle oder hol dir Rat. Du bist nicht machtlos und dein Handeln kann den Unterschied machen.
Sind Außenstehende das gleiche wie Bystander?
- Außenstehende gehören zur Gruppe, in der das Mobbing passiert. Sie kennen die beteiligten Personen meistens und wissen vielleicht, was vorher passiert ist. Ein Beispiel wäre eine Aufsichtsperson auf dem Schulhof. Sie sieht, dass jemand gemobbt wird, greift aber nicht ein.
- Bystander sind Menschen, die zufällig dabei sind und die Beteiligten in der Regel nicht kennen. Sie wissen nichts über die Vorgeschichte. Ein Beispiel wäre eine Reinigungskraft in der Schule, die eine Mobbingsituation beobachtet, aber die Schüler*innen nicht kennt und deshalb nicht eingreift.
Aber ganz egal ob Außenstehende oder Bystander: Dein Handeln kann einen Unterschied machen.
Du bist wichtig, auch wenn du nicht dabei warst.
Angehörige wie Eltern, Geschwister oder andere Bezugspersonen sind oft nicht direkt dabei, wenn Mobbing passiert. Trotzdem können sie bemerken, dass sich etwas verändert: Das Kind wird stiller, zieht sich zurück oder wirkt bedrückt. Auch wenn sie keine klassische Rolle im Mobbinggeschehen haben, können Angehörige viel bewirken.
Was du tun kannst:
- Beobachte aufmerksam: Veränderungen im Verhalten sind oft erste Hinweise.
- Sprich offen und ruhig an, was dir auffällt. Zeig, dass du da bist und zuhörst.
- Vermeide Druck: Gib Raum, ohne zu drängen.
- Hol dir Unterstützung: Lehrkräfte oder Beratungsstellen können helfen.
- Stärke das Selbstvertrauen: Gemeinsame Aktivitäten, Lob und Verständnis helfen, wieder Sicherheit zu gewinnen.
Detaillierte Infos dazu, was Eltern bei Mobbing tun können, findest du im Familienratgeber.